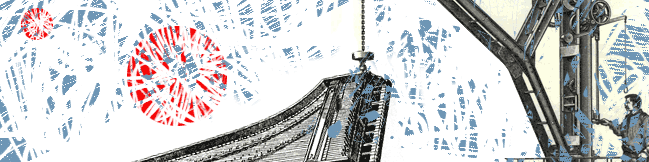Wie kommt der jetzt auf die Strokes? Berechtigte Frage. Schließlich hat die Band aus New York offenbar ihre große Zeit längst hinter sich. Und es liegt nahe, die Strokes als eine dieser klassischen, kurzlebigen Rockphänomene abzutun, als eine dieser Bands, die ihr Pulver viel zu früh verschießen und dann von Ruhm und Geld gelangweilt sich entweder auflösen oder nur noch Belanglosigkeiten raushauen. Man hat das ja oft erlebt, und zuweilen bewahrte nur das frühe Ableben des Sängers eine großartige Band vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit.
Julian Casablancas hat sich bislang nicht umgebracht. Die Strokes sind, zumindest für die musikalische Gegenwart, bedeutungslos geworden. Mit ihrem 2005er Album "First Impressions of Earth" haben sie überzeugend dargelegt, dass ihr Trumpf eine ungestüme, unperfekte Leidenschaft war, die eine Band im Musikbusiness zwangsläufig verlieren muss. Ihr Versuch, sich mit glasklaren Arrangements und kalkulierter Pop-Architektur weiterzuentwickeln, scheiterte jämmerlich, auch weil eigentlich niemand so etwas von ihnen hören wollte. Man konnte sich fragen, ob da zu viele oder zu wenig Drogen im Spiel waren. Da sie alle noch leben, vermutlich letzeres.
Doch wird man den Strokes mit diesem zu kurz greifenden Urteil nicht gerecht. Es ist zwar leider davon auszugehen, dass von ihnen keine bahnbrechenden Werke mehr zu erwarten sind. Doch haben die New Yorker mit ihrem wilden Garage-Rock am Anfang dieses Jahrzehnts eine Welle ausgelöst, deren Nachwirkungen bis heute spürbar sind. Einerseits musikalisch, mit ihrer Rückbesinnung auf handgemachten, leidenschaftlichen und unprätentiösen Indie-Rock. Ihr noch vor "Is this it?" (2001) veröffentliches Demo (auf dem bereits fast alle Hits enthalten waren) war dabei noch wesentlich prägnanter als das spätere Debüt-Album. Andererseits traten The Strokes auch ästhetisch eine Welle los: Nicht nur in ihren Kompositionen, auch in ihren Videos und sogar in ihrem Outfit fanden sich deutliche Frühachtziger-Reminiszenzen, die heute in der Musikszene unübersehbar geworden sind.
Ich erinnere mich noch an ein Live-Konzert, das seinerzeit (2002) auf MTV ausgestrahlt wurde. Als Kind der Achtziger war mir die Mode dieser Zeit ziemlich zuwider. Dann sah ich den Gitarristen Nick Valensi in engen Röhrenjeans und mit einem dieser billig aussehenden Stoff-Jackets auf der Bühne herumstaksen. Alle fünf Musiker sahen für meine Begriffe betont uncool aus. Das machte die Musik natürlich nicht schlechter und war mir letztlich auch ziemlich egal. Der Modewelt aber offenbar nicht: Mittlerweile sieht man viele junge Leute zwischen 15 und 25, die Nick Valensis kleine Geschwister sein könnten. Man denke nur an die ganzen Indie-Chicks, die überall herum laufen und sich, man sehe es ihnen nach, über den süßen Sänger von Billy Talent austauschen (das erwähne ich nur, weil ich es gestern erlebt habe).
Nun ist Mode ein flüchtiger Wert, flüchtiger jedenfalls als Musik. Und auf diesem Feld gibt es Meilensteine, die zurecht in Erinnerung behalten werden. Ein Beispiel ist Nirvana. Was war das für eine grausame Musiklandschaft, in die Nirvana Anfang der Neunziger hineinstürzten: Rock'n Roll-Poser, allen voran die unsäglich käsigen Guns'n Roses, mit Föhnfrisuren und Dauerwellen. Hair-Metal (Europe), Euro-Pop (Snap) und Mammutkonzerte von Rod Stewart. (Leider scheint der ganze Quatsch mittlerweile wieder hip zu sein, vermutlich auch ein Verdienst der Strokes.) Jedenfalls platzten Nirvana mit ihrer rauhen, explosiven Musik und ihrer Fuck You-Attitüde in diese kranke Zeit hinein und sorgten für einen - wenn auch vorübergehenden - Bedeutungsgewinn der Rockmusik. Ihre Ära dauerte gut drei Jahre, brachte zwei Studioalben und unzählige Epigonen hervor. Und natürlich den Medienhype des ominösen Grunge. Wie wir heute wissen, eine ebenso schwammige wie flüchtige Angelegenheit, die im weithin nichtssagenden Begriff des Alternative münden musste.
Als The Strokes 2000 auf der Bildfläche auftauchten, ähnelte die Musiklandschaft der von 1990. Die Rockmusik erging sich wieder einmal in Posen, Nostalgie und Spartenprogrammen. HipHop war längst omnipräsent geworden, die Zukunft vermutete man im Elektronischen und Grunge wurde von peinlichen Patheten wie Creed oder Bush verkörpert. Bands wie Guano Apes oder die gealterten Metallica gruben der Rockmusik eifrig ein tiefes Grab.
Hätte sich Julian Casablancas 2004 umgebracht oder wäre sonstwie verblichen, die Signifikanz der Strokes für das gesamte Jahrzehnt wäre offensichtlich. Stattdessen haben Bands wie The Hives, die Babyshambles oder Kings of Leon für sie das Ruder übernommen. Die Indie-Rockszene ist wieder breit gefächert und sogar teilweise konsensfähig. Es wäre auch ohne die Strokes so gekommen, aber eine Band muss nun mal zur rechten Zeit am rechten Ort das Richtige tun. Viel mehr haben Joy Division oder Nirvana auch nicht vollbracht.
J. Casablancas lebt noch, er ist verheiratet und schaut sich gerne Baseball-Spiele an. Es heißt zwar, die Strokes würden Anfang 2008 eine neue Platte aufnehmen. Aber allzu motiviert scheinen sie nicht mehr zu sein. Das macht auch gar nichts. Auch wenn sie halbwegs in Vergessenheit geraten sind - The Strokes haben ihre Schuldigkeit getan. Ihnen gebühren horrende Tantiemen, glückliche Familien - und sicher das eine oder andere Plätzchen auf Nostalgiesamplern, die irgendwann über dieses Jahrzehnt zusammengestellt werden.